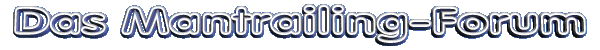Hier also das Ergebnis des angedrohten Nachdenkens:
Eines vorab: Das „ungeeignet“ steht in Anführungszeichen!!!
Ich traile mit meinem Australian Shepherd Oskar (Arbeitslinie), der rassebedingt sicher nicht für das Mantrailing prädestiniert ist.
Der Aussie als Hütehund wird immer versuchen, eine Aufgabe durch Kommunikation mit seinem Menschen, über seine Augen, oder aber durch „nachdenken“ zu lösen. Die Nase ist einfach nicht das (erste) Mittel seiner Wahl.
Heißt:
Wir fahren im Training sehr viel besser, wenn ich den Verlauf der Spur nicht kenne. Ansonsten liest Oskar mich – da kann ich noch so viel Ahnungslosigkeit heucheln. Auch unser Backup muss sich sehr neutral verhalten – sonst liest er den.
Mein Hund kennt mich sehr genau: Er checkt auch solche Verstecke, die ich aussuchen würde…
Die VP selbst zu verstecken habe ich aufgegeben, als Oskar angefangen hat, meine Spur gegen Laufrichtung zu verfolgen, weil der Weg zum Ziel so häufig kürzer war.
All das lässt sich keineswegs mit einem Mangel an Motivation erklären!
Oskar will die gestellte Aufgabe lösen, versucht aber immer, den Weg des geringsten Widerstandes zu finden. Dazu gehört auch, dass er – wenn er in einem Gebiet schon einmal gesucht hat – erst einmal da nachschauen möchte, wo die VP beim letzten Mal war.
Startritual
Die Aussies neigen leider dazu, in spannungsgeladenen Situationen und Startsequenzen aller Art, zu kläffen wie die Geisteskranken. Oft sieht man sie dann auch ihre Menschen maßregeln. Ich habe viel Trainingszeit darein investiert, was auch immer entspannt und gelassen zu starten. Und natürlich möchte ich, dass das so bleibt.
Nähe und Vertrauen lassen sich meiner Ansicht nach nicht durch das Einklemmen schaffen, sondern müssen schon vorhanden sein, damit man seinen Hund überhaupt zwischen die Beine nehmen kann.
Ich trainiere vorzugsweise „körperlos“: Im privaten Umgang miteinander wird Körperkontakt durchaus gepflegt, im Training führe ich meinen Hund über Körpersprache, setze also weder die Leine, noch direkte Berührungen ein.
„Was die Stunde geschlagen hat“, weiß mein Hund, wenn ich die „Trailkiste“ packe. Auch Menschen mit Warnwesten versetzen ihn in eine gewisse Aufregung. Das Fährtengeschirr, das ich zum Trailen benutze, hat er verknüpft. Das ist mir sehr deutlich klargeworden, als ich einmal versucht habe, es für einen Spaziergang zu benutzen: Große Empörung!
Unser Startritual ist eher schlicht: Oskar wartet, bis ich ihm die Kenndecke angelegt und ihn „umgeklinkt“ habe, dann geht er zum GA. Er bekommt ein Hörzeichen – ich denke allerdings, dass er auch ohne Hörzeichen losmarschieren würde, schließlich weiß er ja, wie’s geht.
Bei anderen Aufgaben (z.B. Apportiertraining) leuchtet es mir durchaus ein, einzelne Arbeitsschritte zu trainieren und sie dann wie bei einem Baukasten zusammenzusetzen.
Beim Mantrailing mit einem Hund, der Nasenarbeit nicht als Selbstzweck ansieht, hat das jedoch m.E. wenig Sinn. Da er den Weg nicht als Ziel anzuerkennen vermag, brauche ich das Ziel: Es muss eine Person gefunden werden!
Perimeter
Bei den ersten Versuchen wollte Oskar einfach zum Geruchsartikel und von da aus weiter und hat überhaupt nicht begriffen, warum ich ihn nicht gelassen habe.
Ich hab nicht drauf bestanden, um seinen Tatendrang nicht zu bremsen.
Unterdessen setze ich ihn auch ab und zu abseits der Spur an und habe ihm den Perimeter interessehalber noch einmal angeboten. Und siehe da: Jetzt leuchtet ihm die Sache offenbar ein!
Das Bedürfnis bzw. der Anspruch des Hundes, erst einmal die Lage zu checken, Pipibotschaften zu lesen und selber welche zu hinterlassen, hat in unserem Falle keine Rolle gespielt. Das Checken ist generell meine Aufgabe und bei der Arbeit wird nicht rumgepinkelt.
Korrekturen
Mit Korrekturen muss ich sehr vorsichtig sein.
Ein minimales Zögern reicht, damit mein Hund sich wieder an mir orientiert. Korrigiere ich ihn, weil vielleicht ein Wurstbrot am Weg liegt, das er nicht essen soll, kann es mir passieren, dass er die Spur nicht weiter verfolgt.
Das Checken von Abzweigungen ist für mich eine echte Herausforderung.
Ganz oft zeigt sofort die richtige Richtung an, kann dann aber nicht anders, als alle anderen Möglichkeiten auch abzuhaken.
Habe ich erwähnt, dass Aussies oft Kontrollfreaks sind?
Natürlich verballert er dabei Kraft, aber wenn ich ihn bremse, verlässt er sich sofort darauf, dass diese Richtung es nicht sein kann.
Andererseits neigt er dazu, ganz besonders emsig jeden einzelnen Hauseingang zu checken, wenn er die Spur verloren hat. Wenn er gar nicht weiter weiß, bietet er halt Verhalten an, das sonst ganz oft richtig war.
Warum wir überhaupt trailen?
Weil es uns Spaß macht!
Und weil es praktisch ist.
Rassebedingt muss Oskar arbeiten und seine Arbeit muss anspruchsvoll und abwechslungsreich sein.
Er lernt schnell. Und genauso schnell langweilt er sich auch. Es hat mich einige intellektuelle Verrenkungen gekostet, mein „Cleverle“ bei Laune zu halten…
Beim Mantrailing dagegen ist sowieso jede Spur anders. Ich kann Schwierigkeiten einbauen, muss es aber nicht – meistens ergeben sie sich von selber.
Ich bin übrigens der festen Überzeugung, dass mein Hund „Arbeit“ vom „Tralafitti“ unterscheiden kann. Klar kann er Tricks, klar kennt er Sortierspiele, wahrscheinlich würde er mir zuliebe sogar beim Dogdance mitmachen, aber so richtig „dabei“ ist er nur, wenn ihm der Sinn einleuchtet.
Mantrailing ist eine Herausforderung, die wir gemeinsam stemmen.
Gerade weil Oskar nicht prädestiniert für diese Arbeit ist, können wir gemeinsam an unserer Aufgabe wachsen. Helden im Realeinsatz werden wir sicher nie, aber das war auch nie das Ziel. Ich habe meinen Hund beim Mantrailing ganz anders kennen- und lesengelernt. Und für mich liegt der Schwerpunkt ganz klar darauf, dass wir gemeinsam ein Ziel erreichen.
Last not least:
Langfristig möchte ich Mantrailing therapeutisch nutzen.
Dabei geht es genau nicht darum, erfolgreiche Mantrailer auszubilden!
Allein das Bewusstsein „ich kann was“, kann einem Hund Selbstvertrauen geben.
Das Gefühl „ich bin bei der Arbeit!“, kann helfen, Ängste und Aggression zu kanalisieren.
Die gemeinsame Bewältigung einer Aufgabe schweißt zusammen. Und so ziemlich jede sinnvolle Aufgabe reduziert die Kapazitäten für Blödsinn (sprich: Unerwünschtes Verhalten).
Mantrailing mit „ungeeigneten“ Hunden und Methoden
17 Beiträge
• Seite 1 von 2 • 1, 2
-

Blitzi - Mantrailer
- Beiträge: 548
- Registriert: 23. August 2009 21:06
- Wohnort: Langenfeld / Rheinland
- PLZ: 40764
Re: Mantrailing mit „ungeeigneten“ Hunden und Methoden
Ich mußte beim Lesen schmunzeln, erkenne ich Azunela doch in einigen Punkten wieder. GErne würde ich euch mal live erleben.
Liebe Grüße
Yvonne mit Azunela, Cariño und Luna im Herzen *30.01.2010
Yvonne mit Azunela, Cariño und Luna im Herzen *30.01.2010
-

Azunela - Mantrailer
- Beiträge: 111
- Registriert: 25. November 2008 19:58
- Wohnort: Düsseldorf
- PLZ: 40237
Re: Mantrailing mit „ungeeigneten“ Hunden und Methoden
Du wohnst ja um die Ecke - da ergibt sich sicher mal ne Gelegenheit!
Gruß
Iris
Gruß
Iris
-

Blitzi - Mantrailer
- Beiträge: 548
- Registriert: 23. August 2009 21:06
- Wohnort: Langenfeld / Rheinland
- PLZ: 40764
Re: Mantrailing mit „ungeeigneten“ Hunden und Methoden
Hallo Iris,
so lerne ich endlich Deine Mantrailer Motivation kennen

Hier eignet sich das FunTrailing auf kurzer Distanz sehr gut,
Habe mit FunTrailing Hunden eine neu Perspektive geben können. Neben bei, habe wir die Kommunikationssignale unterschiedlicher Hundetypen beim MT Beobachtet und dokumentiert . Langfristig bis Mittelfristig können einige unliebsame Verhaltensweisen bei unseren Hunden auf wundersame weis verloren gehen.
FunTrailing-, therapeutisch zu nutzen, ist eine vernünftige Methode bestimmte Verhaltensweisen bei Hunden zu verändern. Setz jedoch ein Therapieplan voraus.
so lerne ich endlich Deine Mantrailer Motivation kennen
Blitzi hat geschrieben:Last not least: Langfristig möchte ich Mantrailing therapeutisch nutzen. Dabei geht es genau nicht darum, erfolgreiche Mantrailer auszubilden!
Hier eignet sich das FunTrailing auf kurzer Distanz sehr gut,
Habe mit FunTrailing Hunden eine neu Perspektive geben können. Neben bei, habe wir die Kommunikationssignale unterschiedlicher Hundetypen beim MT Beobachtet und dokumentiert . Langfristig bis Mittelfristig können einige unliebsame Verhaltensweisen bei unseren Hunden auf wundersame weis verloren gehen.
FunTrailing-, therapeutisch zu nutzen, ist eine vernünftige Methode bestimmte Verhaltensweisen bei Hunden zu verändern. Setz jedoch ein Therapieplan voraus.
Mit freundlichen Gruss
Reddog
Die Realität ruiniert einem immer wieder die Hoffnung, das der Mensch das Maß aller Dinge ist.
Reddog
Die Realität ruiniert einem immer wieder die Hoffnung, das der Mensch das Maß aller Dinge ist.
-

Reddog - Mantrailer
- Beiträge: 102
- Registriert: 27. Juli 2009 14:01
- Wohnort: Neunkirchen - Seelscheid
- PLZ: 53819
Re: Mantrailing mit „ungeeigneten“ Hunden und Methoden
Blitzi hat geschrieben:Du wohnst ja um die Ecke - da ergibt sich sicher mal ne Gelegenheit!
Gruß
Iris
Sehr gerne, lass uns mal schauen, ob wir einen Termin finden.
Liebe Grüße
Yvonne mit Azunela, Cariño und Luna im Herzen *30.01.2010
Yvonne mit Azunela, Cariño und Luna im Herzen *30.01.2010
-

Azunela - Mantrailer
- Beiträge: 111
- Registriert: 25. November 2008 19:58
- Wohnort: Düsseldorf
- PLZ: 40237
Re: Mantrailing mit „ungeeigneten“ Hunden und Methoden
Reddog hat geschrieben:FunTrailing therapeutisch zu nutzen, ist eine vernünftige Methode bestimmte Verhaltensweisen bei Hunden zu verändern. Setz jedoch ein Therapieplan voraus.
Einfach "nur" Funtrails zu laufen und sich einzubilden, dass dadurch schon alles gut wird, ist ganz sicher nicht der Weg!
Ich weiß ja nicht, wie Deine Erfahrungen sind... ich erlebe regelmäßig, dass es der Mensch ist, der sich ändern muß.
Sich, sein Verhalten, seine Erwartungen, seine Einstellung zu seinem Hund...
Ist das geschafft, kann ich die gemeinsame Arbeit dazu nutzen, dass Mensch und Hund eine nette Zeit haben (für etliche meiner Kunden bedeutet der eigene Hund eigentlich nur Streß), gemeinsam Erfolge erleben, und irgendwann auch gemeinsam stressige Situationen meistern.
Für meinen Hund wünsche ich mir, dass er so ist wie heute:
Er hat einen guten Job gemacht und ist rechtschaffen müde und zufrieden!
Liebe Grüße
Iris
-

Blitzi - Mantrailer
- Beiträge: 548
- Registriert: 23. August 2009 21:06
- Wohnort: Langenfeld / Rheinland
- PLZ: 40764
Re: Mantrailing mit „ungeeigneten“ Hunden und Methoden
Sind nicht eigentlich immer nur die Halter, die die Fehler machen?? Egal welches Problem man mit seinem Hund hat eigentlich liegt es doch in den meisten der Fälle daran, dass wir ihn nicht richtig lesen und ihn einfach nicht verstehen und uns daraufhin falsch verhalten...
Wirklich schade, dass du es so oft erleben musst, dass Menschen ihren Hund als Stress empfinden Dabei kann ein Hund so viel mehr sein....Ich empfinde ihn eher als Ruhepool in meinem Leben...
Dabei kann ein Hund so viel mehr sein....Ich empfinde ihn eher als Ruhepool in meinem Leben...
Sorry für den OT.
Wirklich schade, dass du es so oft erleben musst, dass Menschen ihren Hund als Stress empfinden
Sorry für den OT.
- Trash83
- Mantrailer
- Beiträge: 50
- Registriert: 28. Juni 2010 23:52
- Wohnort: NRW
- PLZ: 40000
Re: Mantrailing mit „ungeeigneten“ Hunden und Methoden
Wenn unsere KLIENTEN kommen dann haben die schon einiges hinter sich.
Vor allen, eine menge an sog. Hundeschulen.
MT verwende ich um zwei wesentliche Ziele in der Therapie zu erreichen.
1. Dem Hundehalter ein Gespür für das Wesen Hund zu vermitteln.
2. Dem Hund die Möglichkeit zu bieten seine natürlichen ohlfaktorische Verhaltensweisen zu entwickeln und aus zu leben.
Da stimme ich dir zu! Aber wie willst Du das verhindern?
Ich bin zu lange in diesem Tätigkeitsfeld tätig. Ich weis was ich tue, und bin mir meiner schritte sehr bewusst. Die Erfolge die wir haben, sprechen für sich.
Einem Hund nur hinter her zu rennen, damit ist es sicherlich nicht getan. Hier müssen schon erhebliche Veränderungen beim Halter herbei geführt werden.
Und schon sind wir wieder in der Psychokiste.
Vor allen, eine menge an sog. Hundeschulen.
MT verwende ich um zwei wesentliche Ziele in der Therapie zu erreichen.
1. Dem Hundehalter ein Gespür für das Wesen Hund zu vermitteln.
2. Dem Hund die Möglichkeit zu bieten seine natürlichen ohlfaktorische Verhaltensweisen zu entwickeln und aus zu leben.
Blitzi hat geschrieben:Einfach "nur" Funtrails zu laufen und sich einzubilden, dass dadurch schon alles gut wird, ist ganz sicher nicht der Weg!
Da stimme ich dir zu! Aber wie willst Du das verhindern?
Ich bin zu lange in diesem Tätigkeitsfeld tätig. Ich weis was ich tue, und bin mir meiner schritte sehr bewusst. Die Erfolge die wir haben, sprechen für sich.
Einem Hund nur hinter her zu rennen, damit ist es sicherlich nicht getan. Hier müssen schon erhebliche Veränderungen beim Halter herbei geführt werden.
Und schon sind wir wieder in der Psychokiste.
Mit freundlichen Gruss
Reddog
Die Realität ruiniert einem immer wieder die Hoffnung, das der Mensch das Maß aller Dinge ist.
Reddog
Die Realität ruiniert einem immer wieder die Hoffnung, das der Mensch das Maß aller Dinge ist.
-

Reddog - Mantrailer
- Beiträge: 102
- Registriert: 27. Juli 2009 14:01
- Wohnort: Neunkirchen - Seelscheid
- PLZ: 53819
Re: Mantrailing mit „ungeeigneten“ Hunden und Methoden
@Reddog Was genau machst du in dem Bereich denn? Hört sich spannend an!
- Trash83
- Mantrailer
- Beiträge: 50
- Registriert: 28. Juni 2010 23:52
- Wohnort: NRW
- PLZ: 40000
Re: Mantrailing mit „ungeeigneten“ Hunden und Methoden
Iris,
Glückwunsch zu den tollen Ausführungen!!
Ich gehe da absolut konform, weil es mit meiner Schäfi-Hündin in vielen Bereichen genauso ist wie bei dir.
Ich z.B. MUSS ruhig starten, sonst habe ich ein hochgepushtes ziehendes Pelzbündel mit 32 kg an der Leine, was ich absolut nicht will! Ich mache u.a. MT, weil sie eben genau das Gegenteil lernen soll: Kopf einsetzen und Ruhe bewahren!! Action kann sie in anderen Bereichen ihres Lebens genug haben! Auch sie ist aus der Arbeits- und Leistungslinie.
Ich würde übrigens dem Treffen mit dir und Yvonne liebend gerne beiwohnen!!
Glückwunsch zu den tollen Ausführungen!!
Ich gehe da absolut konform, weil es mit meiner Schäfi-Hündin in vielen Bereichen genauso ist wie bei dir.
Ich z.B. MUSS ruhig starten, sonst habe ich ein hochgepushtes ziehendes Pelzbündel mit 32 kg an der Leine, was ich absolut nicht will! Ich mache u.a. MT, weil sie eben genau das Gegenteil lernen soll: Kopf einsetzen und Ruhe bewahren!! Action kann sie in anderen Bereichen ihres Lebens genug haben! Auch sie ist aus der Arbeits- und Leistungslinie.
Ich würde übrigens dem Treffen mit dir und Yvonne liebend gerne beiwohnen!!
- Kendy
- Mantrailer
- Beiträge: 18
- Registriert: 9. März 2010 07:55
- PLZ: 51645
Re: Mantrailing mit „ungeeigneten“ Hunden und Methoden
Reddog hat geschrieben:Wenn unsere KLIENTEN kommen dann haben die schon einiges hinter sich.
Vor allen, eine menge an sog. Hundeschulen.
MT verwende ich um zwei wesentliche Ziele in der Therapie zu erreichen.
1. Dem Hundehalter ein Gespür für das Wesen Hund zu vermitteln.
2. Dem Hund die Möglichkeit zu bieten seine natürlichen ohlfaktorische Verhaltensweisen zu entwickeln und aus zu leben.Blitzi hat geschrieben:Einfach "nur" Funtrails zu laufen und sich einzubilden, dass dadurch schon alles gut wird, ist ganz sicher nicht der Weg!
Da stimme ich dir zu! Aber wie willst Du das verhindern?
Ich bin zu lange in diesem Tätigkeitsfeld tätig. Ich weis was ich tue, und bin mir meiner schritte sehr bewusst. Die Erfolge die wir haben, sprechen für sich.
Einem Hund nur hinter her zu rennen, damit ist es sicherlich nicht getan. Hier müssen schon erhebliche Veränderungen beim Halter herbei geführt werden.
Und schon sind wir wieder in der Psychokiste.
Solange Du's nur besser weißt...
"Olfaktorisch" schreibt man übrigens ohne h.
Gruß
Iris
-

Blitzi - Mantrailer
- Beiträge: 548
- Registriert: 23. August 2009 21:06
- Wohnort: Langenfeld / Rheinland
- PLZ: 40764
Re: Mantrailing mit „ungeeigneten“ Hunden und Methoden
Danke Frau Generaldirektorin 



Mit freundlichen Gruss
Reddog
Die Realität ruiniert einem immer wieder die Hoffnung, das der Mensch das Maß aller Dinge ist.
Reddog
Die Realität ruiniert einem immer wieder die Hoffnung, das der Mensch das Maß aller Dinge ist.
-

Reddog - Mantrailer
- Beiträge: 102
- Registriert: 27. Juli 2009 14:01
- Wohnort: Neunkirchen - Seelscheid
- PLZ: 53819
Re: Mantrailing mit „ungeeigneten“ Hunden und Methoden
Kendy hat geschrieben:Ich würde übrigens dem Treffen mit dir und Yvonne liebend gerne beiwohnen!!
Sehr sehr gerne! Dann schaut mal in eure Kalender. Bei mir sieht es am Wochenende gut aus, bisher habe ich noch nichts geplant.
Liebe Grüße
Yvonne mit Azunela, Cariño und Luna im Herzen *30.01.2010
Yvonne mit Azunela, Cariño und Luna im Herzen *30.01.2010
-

Azunela - Mantrailer
- Beiträge: 111
- Registriert: 25. November 2008 19:58
- Wohnort: Düsseldorf
- PLZ: 40237
Re: Mantrailing mit „ungeeigneten“ Hunden und Methoden
Azunela hat geschrieben:Kendy hat geschrieben:Ich würde übrigens dem Treffen mit dir und Yvonne liebend gerne beiwohnen!!
Sehr sehr gerne! Dann schaut mal in eure Kalender. Bei mir sieht es am Wochenende gut aus, bisher habe ich noch nichts geplant.
Das haut bei mir nicht hin.
Samstag muß ich arbeiten und sonntags hab ich ja schon Rhein Sieg Training.
Wie wäre es denn am Samstag darauf?
Da könnte ich nachmittags.
Gruß
Iris
-

Blitzi - Mantrailer
- Beiträge: 548
- Registriert: 23. August 2009 21:06
- Wohnort: Langenfeld / Rheinland
- PLZ: 40764
Re: Mantrailing mit „ungeeigneten“ Hunden und Methoden
Da bin ich, wenn alles wie gewünscht klappt, wieder an der Nordsee für das ganze Wochenende.
Geht es bei dir denn auch in der Woche?
Geht es bei dir denn auch in der Woche?
Liebe Grüße
Yvonne mit Azunela, Cariño und Luna im Herzen *30.01.2010
Yvonne mit Azunela, Cariño und Luna im Herzen *30.01.2010
-

Azunela - Mantrailer
- Beiträge: 111
- Registriert: 25. November 2008 19:58
- Wohnort: Düsseldorf
- PLZ: 40237
17 Beiträge
• Seite 1 von 2 • 1, 2
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast